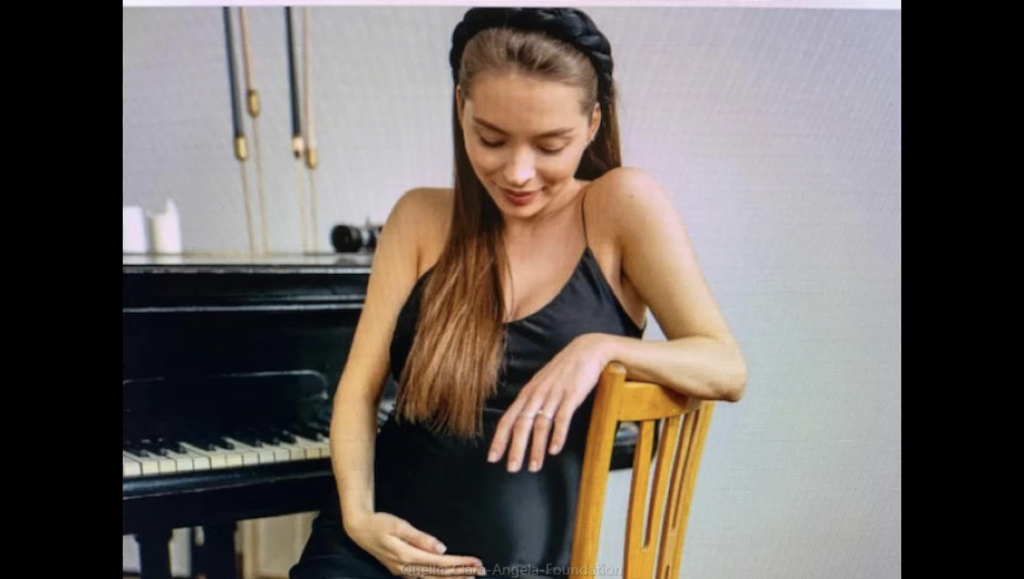Heute habe ich einen Buchtipp für alle, die Lust haben, ihre Nase über die Ostertage mal wieder in ein wissenschaftliches Buch zu stecken. Dieses hat mich begeistert! Es ist erhellend und inspirierend für alle, die sich beruflich mit der therapeutischeren Wirkung von Schreibinterventionen befassen.
Carmen Unterholzer liefert in ihrem jüngst im Carl-Auer-Verlag erschienen Buch weit mehr, als der Titel vermuten lässt: Eine umfassende und großartig strukturierte Übersicht zur Nutzung von Schreibinterventionen im therapeutischen Feld. Wenn auch systemische Ansätze im Mittelpunkt stehen, werden sie auf der Basis eines erweiterten Spektrums diskutiert. Die Autorin gewährt Einblicke in die eigene Arbeit und zeigt auf, wo besonders in Deutschland noch einiges an Wirkungsforschung zu leisten sein wird.
Stiefkind der deutschen Wissenschaft
Zum Thema Schreibtherapie wurde in Deutschland bislang viel zu wenig systematisch geforscht und publiziert. Unsere europäischen Nachbarn, Skandinavien und die USA sind uns diesbezüglich gleich mehrere Nasenlängen voraus. Nicht nur, wenn es um die Wirkung des Expressiven Schreibens geht, der bis heute am besten erforschten Schreibintervention nach James Pennebaker und seinen KollegInnen. Viele internationale Forschungsarbeiten, deren Ergebnisse nicht nur für ein kleines Fachpublikum interessant sein dürften, haben den Weg an die Öffentlichkeit bei uns noch nicht gefunden, das wurde mir bei der Lektüre klar.
Neben Silke Heimes (2012), Lutz von Werder (2012), Barbara Schulte-Steinicke (2000), Renate Haußmann und Petra Rechenberg-Winter (2013) sowie Petra Rechenberg-Winter und Antje Randow-Ruddies (2017) haben sich bei uns bislang nur wenige WissenschaftlerInnen dem Schreiben im therapeutischen Kontext gewidmet. Hinweise dazu finden sich versprengt in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist sehr bedauerlich, denn für die heilende Kraft des Schreibens gibt es seit der Antike viele Belge – von autobiografischen Schriften bis hin zum klassischen Drama.
Unterholzer steigt über die enge Beziehung zwischen Literatur und Therapie ins Thema ein. Mit Zitaten namhafter AutorInnen zeigt sie im ersten Kapitel, dass Selbstheilungsbestrebungen auch bei der Literaturproduktion fast immer Pate stehen. Das deckt sich mit den Erfahrungen, die wir als SUDIJUMI immer wieder machen, wenn wir mit Autoren arbeiten, die uns zur Begleitung ihrer Buchprojekte buchen. Es erstaunt wenig, denn auch in der Literatur geht es immer um die großen Fragen der menschlichen Existenz: Lebenssinn und -ziele, Liebe, Tod, Ängste, Schuld und Verstrickungen. Unterholzer weist jedoch zu Recht darauf hin, dass es beim therapeutischen Schreiben niemals um das literarische Produkt geht. Es ist der Prozess, in dessen Verlauf sich die heilsame Wirkung entfaltet. Wir würden hinzufügen, dass sich dennoch immer wieder literarische Perlen daraus entwickeln können.
Im nächsten Schritt präsentiert Unterholzer ihrer Leserschaft, beginnend mit einem kurzen Abriss der Urgeschichte des therapeutischen Schreibens, eine umfangreiche Zusammenstellung der begleitenden Nutzung von Schreibinterventionen im therapeutischen Umfeld. Diese existierte in mehreren europäischen Ländern bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts! Daher erstaunt es besonders, dass bis heute in der deutschen Öffentlichkeit nur ein geringes Wissen darüber existiert. In letzter Konsequenz führt das zur Weigerung der Krankenkassen, die Schreibtherapie anderen künstlerischen Interventionen gleichzusetzen. Selbst Yoga, eine junge Disziplin, deren Siegeszug erst in den 1970er Jahren begann, hat in diesem Kontext einen höheren Stellenwert als das Schreiben. Dabei ist es ein Ansatz, der überall und kostengünstig eingesetzt werden kann. Susan Borkin (2014) beschreibt in „The Healing Power of Writing“, wie die Anzahl der Therapiestunden durch Schreibinterventionen verkürzt werden kann.
Doch zurück zu Unterholzer.
Im zweiten Hauptkapitel behandelt die Autorin die zahlreichen Untersuchungen zum Expressiven Schreiben, um anschließend die schreibtherapeutischen Ansätze der Integrativen Psychotherapie, der Verhaltenstherapie und der Bibliotherapie vorzustellen.
Super strukturiert
Sehr gelungen finde ich persönlich die Grafiken am Ende eines jeden Kapitels, in denen kurz und knapp dargestellt wird, wo die Besonderheiten und Unterschiede des jeweiligen Ansatzes liegen. So geht es beispielsweise in der Integrativen Therapie darum, schreibend verschiedene Interpretationsweisen von Lebensgeschichten sichtbar zu machen. Verhaltenstherapeuten setzen auf kognitive Umstrukturierung, während Schreibinterventionen im Rahmen der Systemischen Therapie eingesetzt werden, um Traumata zu transformieren und/oder in der Klientennarration neue Geschichten zu entdecken, um diese anschließend bestmöglich zu verankern. Unterholzer bezieht sich dabei auf Forschungsarbeiten aus England, den Niederlanden, Italien und Dänemark. Dieser Forschungsüberblick ist meines Erachtens eine der ganz großen Stärken ihres Buches, denn mangels eines entsprechenden Lehrstuhls für Therapeutisches Schreiben – selbst an der Alice-Salomon-Universität in Berlin, die für Gesundheitsberufe ausbildet und im Rahmen des Masterstudiengangs Biografisches und kreatives Schreiben auch ein Medizinmodul anbietet – wird dieses Thema noch unzureichend beleuchtet.
Auf die Arbeit im Rahmen der Systemischen Therapie, geht Unterholzer im Folgekapitel intensiv ein. Hier zeigt sie, wie die klassischen Methoden dieser Therapierichtung schreibtherapeutisch umgesetzt werden können und mit welchen Textsorten vornehmlich gearbeitet wird, um Probleme zu externalisieren. Dabei werden z.B. schmerzhafte Inhalte aus der gewohnten Erzählweise der Klienten herausgelöst und in einen neuen Kontext gesetzt (Reframing). Lösungen, die Klienten dabei entwickeln, werden in den nächsten Schritten verinnerlicht und verfestigt. Briefe, Gedichte, Tagebucheinträge, Lyrik und Erzählungen werden in ihrer Wirkungsweise betrachtet und auf die jeweilige Phase der Therapie bezogen. Ein Teilkapitel ist den Besonderheiten von Gruppen – und Einzetherapien gewidmet.
Behandelt wird ferner die Frage, welche Menschen besonders vom Schreiben profitieren, wo Vorsicht geboten ist, bzw. Schreibinterventionen kontraproduktiv sein können. Auf der Basis von Tiefeninterviews, die Unterholzer mit 16 KlientInnen geführt hat, erläutert sie die erlebte Wirkungsweise von Schreibinterventionen und zieht ganz zum Schluss noch einmal ein Resümee.
Vision: Schreiben auf Rezept
Meine persönlichen AHA-Momente beziehen sich darauf, mit meiner Teamkollegin Susanne Diehm und dem von uns entwickelten GKS (Gesundheitsfördernden Kreativen Schreiben) auf dem richtigen Weg zu sein: Viele der von Unterholzer beschriebenen Schreibinterventionen aus den unterschiedlichen Disziplinen haben wir ebenfalls im Repertoire – allerdings in einer völlig anderen Mischung und mit einer anderen Zielrichtung. Wir sind davon überzeugt, dass jedes Schreiben therapeutisch wirkt, aber wir bewegen uns mit GKS auf einer therapeutischen Vorstufe. Uns geht es um Gesundheitsprophylaxe und Resilienzstärkung und dazu setzen wir verstärkt auf die kreativen Aspekte des Schreibprozesses. Denn die – da sind wir uns mit Unterholzer einig – scheinen einen besonders intensiven Einfluss auf die Entwicklung von Vertrauen in die Selbstwirksamkeit zu haben. Das ist jene starke Kraft, die Menschen die Sicherheit gibt, auch schwierige Lebenssituationen erfolgreich meistern zu können.
Auf entspannte und freudige Art mobilisieren wir mit unseren Schreibinterventionen Mut und Autonomiebewusstsein und fördern damit die Selbstheilungskräfte unserer Klienten. Mit fein aufeinander abgestimmten Übungen nehmen wir unseren Klienten die Angst und den Leistungsdruck, den viele Menschen seit der Schulzeit mit dem Schreiben verbinden. Sie finden beflügelt von kleinen zu größeren Texten und wieder zurück zur Verdichtung.
Im Gegensatz zu Therapiepatienten, die Schreiben als Unterstützung in einer „dunklen Phase“ der mühseligen Befreiung von psychischen Belastungen erlebt haben, geben unsere Beobachtungen Anlass zur Vermutung, Resilienz förderndes Schreiben könne nachhaltiger wirken. Die Lust am Schreiben nutzt sich weniger schnell ab, weil sie mit kreativen Erfolgserlebnissen verbunden wird. Auch wenn wir das (noch) nicht wissenschaftlich belegen können, glauben wir, genau das sei der Punkt, an dem eine langfristige Gesundheitsprophylaxe greift – ähnlich wie beim Sport, wo auch nur regelmäßiges Training Erfolge bringt. Aber auch das muss im Rahmen eines Forschungsvorhabens belegt werden. Diesbezüglich hoffen wir auf die Zusammenarbeit mit der Charité, wo wir auf Anregung von Professor Jalid Sehouli mit Eierstockkrebspatientinnen arbeiten.
Damit schließen wir nahtlos an Unterholzers letztes Teilkapitel, „Offene Fragen“. Ja, möchten wir der Autorin zurufen, genau! Es gibt noch vieles zu entdecken im Bereich der Schreibwirkungsforschung. Hoffen wir auf viele erhellende Studien, die dazu beitragen, dass Schreiben auf Rezept irgendwann keine Vision mehr sein muss.