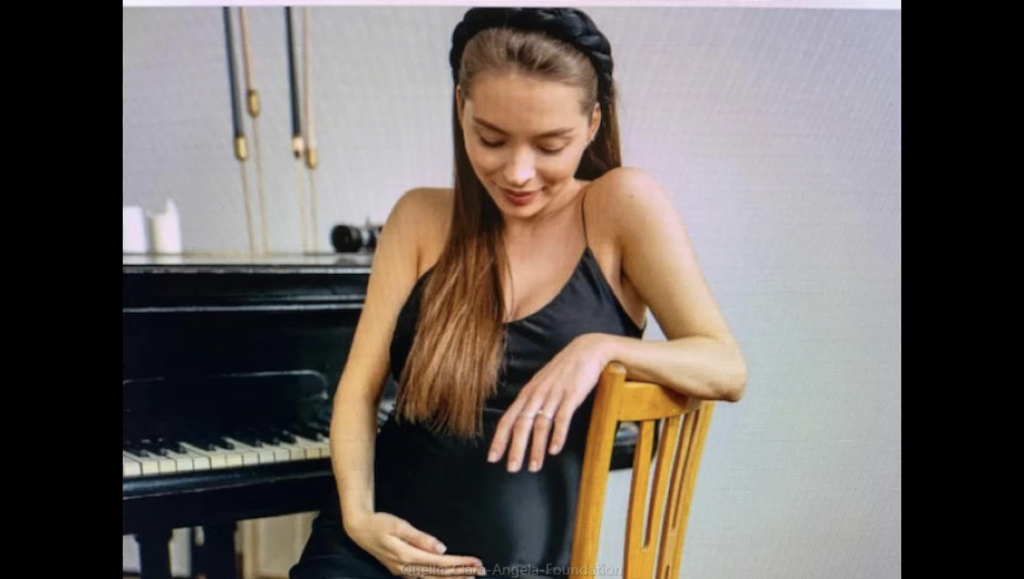Mein Lesejahr 2019 begann mit „Becoming“ dem inspirierenden Memoir von Michelle Obama. Dieses Buch ist in seiner Fülle schier unglaublich und liest sich spannend wie ein gesellschaftskritischer Roman von Emile Zola. Eine klassische Heldenreise, die hoffentlich noch lange weitergehen wird, denn diese Protagonistin hat noch viel zu geben.
Mein Lesejahr 2019 begann mit „Becoming“ dem inspirierenden Memoir von Michelle Obama. Dieses Buch ist in seiner Fülle schier unglaublich und liest sich spannend wie ein gesellschaftskritischer Roman von Emile Zola. Eine klassische Heldenreise, die hoffentlich noch lange weitergehen wird, denn diese Protagonistin hat noch viel zu geben.
„Das Private ist politisch“
Es gibt Sprüche, die klingen wie ein alter Hut, bleiben dennoch ewig aktuell. „Das Private ist politisch“, ein typischer Spruch der 1980er Jahre, ist so einer. Vieles, was uns wie selbst verschuldet oder gar als „Versagen“ vorkommt – das ist damit gemeint – hat viel mit den gesellschaftlichen Strukturen zu tun, die unser Potenzial entweder fördern oder hemmen.
Oft fällt mir der Spruch bei der Arbeit mit den Auszubildenden ein, die ich bei ubs e.V. als Ausbildungscoach betreue. Vieles, was mir dort begegnet, ist Folge von struktureller Benachteiligung, die sich auf wichtige Erfolgsfaktoren wie Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein niederschlägt. Wer nichts von sich erwartet, versucht gar nicht erst, eine Lebensvision zu entwickeln – es sei denn, er oder sie trifft auf ermutigende Mentoren, die ungeahnte Möglichkeiten aufzeigen.
Entwicklung braucht Ermutigung
Wie positiv Ermutigung sich auswirkt, zieht sich wie ein roter Faden durch die Biografie von Michelle Obama, „Becoming“, zu Deutsch: „Werden“.
Wie die meisten Auszubildenden bei ubs stammt die ehemalige First Lady aus einfachen Verhältnissen. Beengte Wohnverhältnisse, Geldknappheit, soziale und politische Diskriminierung – all das hat sie auf unterschiedlichen Ebenen bis heute immer wieder erlebt. Selbst als Frau des amerikanischen Präsidenten musste sie sich immer wieder gegen Vorurteile und Stereotype zur Wehr setzen.
Während ein Migrationshintergrund in Deutschland oft zum Ausschlusskriterium wird, reicht in den USA bereits die Hautfarbe, um von vielen Lebenschancen ausgeschlossen zu werden. Die perfekte Beherrschung der Sprache und gute Schulnoten helfen dort nur wenig weiter. Noch schwieriger wird es, wenn man im falschen Bezirk aufwächst.
Michelle Obama wuchs mit vielen schmerzhaften Geschichten von verwehrten Bildungschancen, Berufszugängen und verweigerten Beförderungen auf. Sie erlebte, wie ihre Nachbarschaft auf der Südseite von Chicago zunehmend verarmte, weil jeder, der konnte, in die „besseren“, die weißen Vororte umzog, weil der politische Wille fehlte, in die Infrastruktur einer schwarzen Wohngegend zu investieren. Es geschah, was in solchen Fällen meist geschieht: Wer trotz Fleiß und Können keine Chance hat, seine Lebenssituation zu verbessern, verbittert. Verliert den Glauben an Gerechtigkeit und demokratische Strukturen, gibt auf, geht nicht mehr zur Wahl und vermindert damit die letzten Chancen, Einfluss auf die Politik zu nehmen.
Michelle Robinson, so ihr Mädchenname, hatte das Glück, in einer unterstützenden Familie aufzuwachsen, in der aufgeben keine Option war. Ihr Vater, schwer an MS erkrankt, engagierte sich als Wahlleiter der Demokraten persönlich dafür, Menschen zur Wahl zu bewegen. Traumatischen Erlebnissen trotzend, wurde in ihrer Familie großer Wert auf Bildung gelegt. Ihre Eltern gehörten nicht zu den Menschen, die bereit sind, Ungerechtigkeiten hinzunehmen, sondern lehrten ihre Kinder, für sich und ihre Rechte einzustehen. Sie waren zu jedem Opfer bereit, um Michelle und ihrem Bruder die Bildung zu ermöglichen, die ihnen selbst versagt geblieben war.
Liebe und Selbstvertrauen als Resilienzfaktoren – auch das ist politisch
Mit beeindruckender Offenheit beschreibt Michelle Obama Verletzungen und Stereotypisierungen, die jeder kennt, der in den Augen der Mehrheit „anders“ ist, sei es aufgrund der Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung. Doch eingebettet in eine Familie, in der auch Großeltern, Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins eine wichtige Rolle spielten, wurden ihr vor allem zwei Dinge vermittelt: „Du wirst geliebt“ und „Du kannst viel erreichen, wenn du dir nur selbst vertraust.“ Kein Wunder, dass der Begriff „Resilienz“ in ihrem gut 400 Seiten umfassenden Memoir immer wieder auftaucht. Denn Resilienz bedeutet auch, trotz Rückschlägen immer wieder aufzustehen und sich auf keinen Fall verbiegen zu lassen.
Ihr Werdegang zeigt eindringlich, wie wichtig es ist, von klein auf Unterstützung und Förderung zu erleben. Hätte sie jemals die Prestige-Universitäten von Princeton und Havard besucht, wenn ihre Mutter in der 3. Klasse nicht gegen eine unfähige Klassenlehrerin protestiert und ihre Tochter aus der Klasse genommen hätte? Michelle Obama hat sich diese Frage oft gestellt. Ihre Antwort ist ein eindeutiges „Nein“, denn sie erinnert sich an Mitschüler*innen, die ebenfalls das Zeug zur Karriere gehabt hätten, wäre ihr Talent nicht in einer Klasse versackt, wo Frust zu Verweigerung und Chaos geführt hatte.
Auch später hat sie immer wieder erlebt, wie es sich anfühlt, aufgrund ihrer Hautfarbe unterschätzt zu werden. Sie sei „kein Princeton-Material“, befand eine Schulberaterin. Nachdem die Tränen getrocknet waren, bat sie einen anderen Berater um eine Empfehlung für die Uni und erhielt sie. Auf den Elite-Colleges Princeton und Havard fand sie sich oft als einzige Schwarze in ihren Kursen wieder, argwöhnisch beobachtet und als „Sozialprojekt“ verdächtigt. Dass sie aufgrund hervorragender Noten dort war, passte schlicht nicht ins Weltbild.
Zum Glück traf sie immer wieder auf Mentoren, die ihre Talente sahen und förderten. Diese Erfahrungen sind es, die sie bis heute in ihrem Gefühl bestärken, etwas von diesem Glück weitergeben zu müssen. Lange bevor sie zur First Lady wurde, verließ sie ihren hochdotierten Karrierejob in einer angesehenen Rechtsanwaltskanzlei, um sich dem Aufbau von „Public Allies“ zu widmen, einer Organisation, die junge Menschen aus Problembezirken für community services qualifiziert. Und das ist nur ein Beispiel von vielen.
„You may live in a world as it is, but you can still create the world as it should be“
Dieser Satz stammt von Barak Obama, drückt aber die geteilte Überzeugung des Ehepaars aus. Michelle Obama gibt freimütig zu, sich manchmal vom Optimismus ihres Mannes überfordert gefühlt zu haben. Und dennoch: Während der Zeit im Weißen Haus galt ihr Engagement neben Kindern und jungen Frauen immer wieder besonders jungen Menschen, deren Schulen schlecht ausgestattet sind und die unter psychischen Barrieren leiden, die sie von höherer Bildung fernhalten.
Mit ihrem Wissen um die Eintrittsbarrieren, Denkweisen und Hintergründe von Menschen, die am gesellschaftlichen Rand leben, startete sie viele Initiativen, die für die Betroffenen einen großen Unterschied ausmachen. Oft mit unkonventionellen Mitteln. Als erste First Lady legte sie beispielsweise gemeinsam mit Kindern aus benachbarten Schulen im Weißen Haus einen Gemüsegarten an, um gesunde Ernährung zu propagieren. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass in vielen Schulkantinen gesünderes Essen ausgegeben wird, regelmäßige Bewegungseinheiten für Grundschulkinder eingeführt wurden und während Obamas Amtszeit die Fettleibigkeit von Kleinkindern durch gezielte Aufklärungsmaßnahmen erheblich gesenkt wurde.
Eine starke Botschaft
Wie weit es ein Mensch bringen kann, sei nicht allein von dessen intellektuellen Kapazitäten abhängig, sondern von gezielter Förderung und dem unerschütterlichen Glauben, „gut genug“ zu sein. Das ist Obamas Botschaft an die Leser. Auch eine starke und beständige Verbindung zu Familie und Freunden gehöre zu den Dingen, die Menschen die Kraft geben. Auch diese Erfahrung zieht sich als ständiges Motiv durch das Buch.
„Becoming“ ist eine geniale Mischung aus Autobiografie, Gesellschaftsanalyse, Einsichten in die politische Funktionsweise der USA und ihren Spielregeln. Nebenbei bedient es aber auch ganz banale Fragen wie die, wie es sich im Weißen Haus so leben lässt.
Was die Autorin in meinen Augen, abgesehen von ihrem unermüdlichen Engagement, besonders sympathisch macht, ist ihre Bescheidenheit. Nie sonnt sie sich im Ruhm Einer, die „es“ geschafft hat. Stattdessen zeigt sie sich und ihre Familie mit Alltagsthemen, die wir alle kennen. Zu Beginn von Obamas Präsidentschaftskandidatur wurde ihr die Bemerkung vorgeworfen, ihr Mann ließe seine Socken in der Wohnung liegen wie jeder andere Mann. Doch genau das ist es, was sie der Öffentlichkeit zeigen möchte: Auch Titelträger sind nur Menschen.
Wer sich für soziale Zusammenhänge interessiert und den oben zitierten Spruch anhand einer sehr persönlich erzählten Entwicklungsgeschichte nachvollziehen möchte, ist bei diesem Buch richtig.
Ach ja, noch ein Aha-Erlebnis für mich: Beide Obamas sind überzeugte Journalschreiber. Schreibzeit entwickelt!